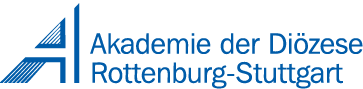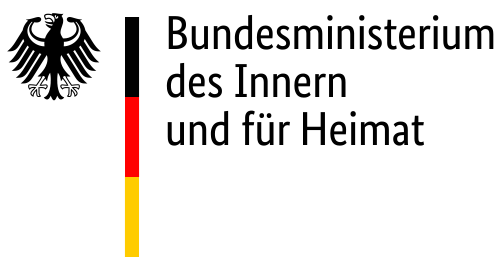„Was zwischen Geburt und Tod liegt, ist der Dialog“ – mit diesen Worten schließt Tommy Seefeld seinen preisgekrönten Essay über Tod und Groteske als Brücken zwischen den Religionen. „Drum lasst uns mehr darüber reden, was uns am Ende eint – das Ende selbst“, fordert der Erstplatzierte des Essay-Wettbewerbs der Georges-Anawati-Stiftung und trifft damit den Kern dessen, worum es beim interreligiösen Dialog geht: das Gemeinsame zu finden, auch dort, wo es zunächst verborgen scheint.
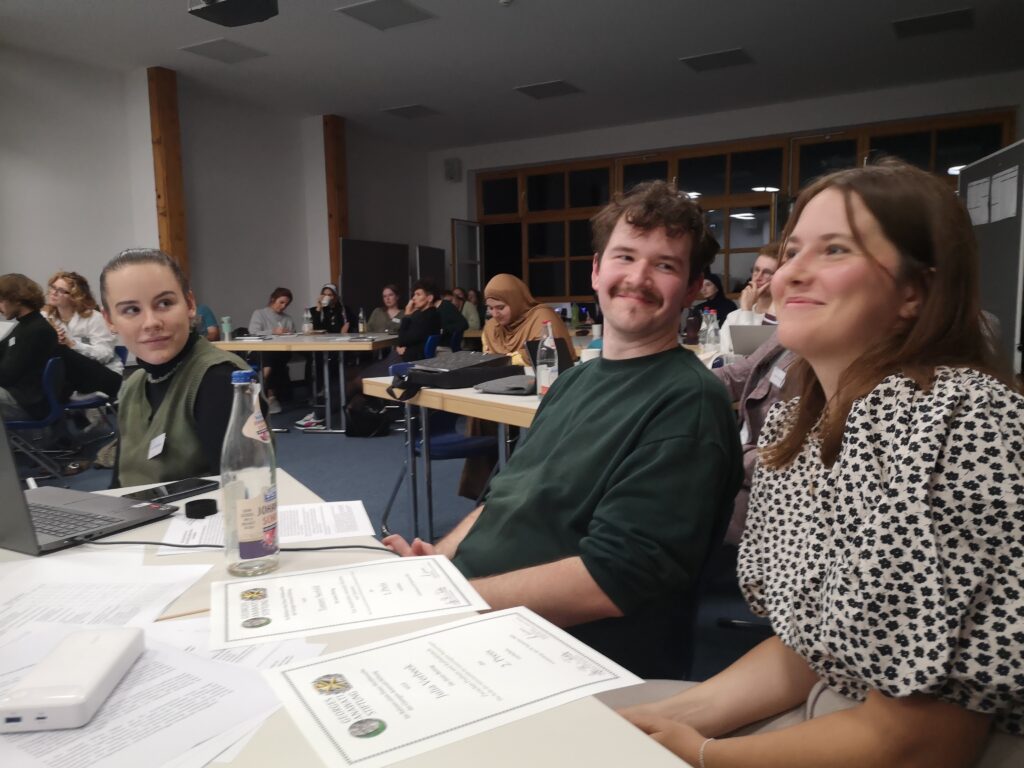
Von Atombomben über Kaffeepausen bis hin zur muslimischen Gefängnisseelsorge – die drei ausgezeichneten Essays zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und lebensnah der christlich-islamische Dialog sein kann. Am 29. September ehrte die Georges-Anawati-Stiftung im Rahmen der interreligiösen Studienwoche (28. September bis 3. Oktober 2025) drei Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, deren Arbeiten neue Wege der Verständigung aufzeigen.
Der Festabend fand statt innerhalb der interreligiösen Studienwoche 2025, die von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Eugen-Biser-Stiftung veranstaltet wird und mit dem Theologischen Forum Christentum – Islam verbunden ist. Dreißig Studierende und Promovierende aus den christlichen (katholischer und evangelischer) und islamischen Theologien, Religions- und Kulturwissenschaften kamen zusammen, um die diesjährige Preisverleihung des Essaywettbewerbs zu feiern und unter dem Leitmotiv „Frieden und Gerechtigkeit als Zentralfragen der Religionen“ zu diskutieren.
Die Festreden hielten Rabbiner Drs. Edward van Voolen und Prof. Dr. Heinz-Günter Schöttler; die Laudatio und Preisverleihung übernahm Prof. Dr. Harald Suermann.

Bereits in der Eröffnung wurde das Anliegen des Abends deutlich: Theologie steht in einer dauerhaften Verpflichtung, zwischen hohen Friedensutopien und ernüchternder Realität eine tragfähige Sinnklärung zu leisten und Hoffnungsperspektiven zu eröffnen. Nicht mehr der Singular einer theologischen Disziplin, sondern das Zusammenspiel der jüdischen, christlichen und islamischen Theologien, in Verbindung mit „allen Menschen guten Willens“, kann Antworten auf die drängenden Gegenwartsfragen finden.
Vor diesem Hintergrund verortete Rabbiner van Voolen seinen Beitrag in den jüdischen Feiertagen zwischen Rosch ha-Schana und Jom Kippur, deren Leitworte Barmherzigkeit, Gebet, Umkehr und Gerechtigkeit sowie Wohltätigkeit sind. Die biblischen Erzählungen von Hagar und Ismael sowie Isaak las er als Gegenwartsanruf: Gott hört den Schrei der Verzweifelten und verheißt Zukunft – eine Einladung, heute die Stimmen von Israelis und Palästinensern gleichermaßen zu hören. Der Priestersegen entfaltet, so van Voolens Auslegung, eine dynamische Friedensmatrix vom Schutz über die Gnade bis zum Schalom, während die Prophetenworte Jesajas und Sacharjas eine Ethik der Gerechtigkeit und der Gewaltfreiheit in die Gegenwart hinein buchstabieren. Van Voolen verband dies mit der nüchternen Einsicht, dass kein Volk in Frieden leben kann, wenn es ein anderes Volk unterdrückt, und dass nirgends Frieden selbstverständlich ist. Hoffnung entstehe im Miteinander: im Dialog, in demokratischer Erneuerung, im Wiederaufbau von Vertrauen, in internationaler Vermittlung – und in der sorgfältigen Dokumentation von Unrecht als Grundlage künftiger Gerechtigkeit. „Jede Begegnung ist wichtig. Jeder Schritt zählt“, fasste er seine Hoffnungspraxis zusammen.
Prof. Schöttler stellte seinen praktisch-theologischen Akzent gegen eine „Diskurs-Unerbittlichkeit“ in Gesellschaft und Politik. Er kontrastierte Hassrhetorik, Endkampf-Narrative und das Aufrechnen von Kollateralschäden mit den Seligpreisungen des Matthäusevangeliums: Gewaltlosigkeit, Barmherzigkeit und der Hunger nach Gerechtigkeit bilden den biblischen Horizont. Im Zentrum stand die bei Johann Baptist Metz profilierte Compassio, das Eingedenken fremden Leids – auch des Leids der Feinde –, als universale Verantwortung und als reale Voraussetzung jeder Friedenspolitik. Ohne die Bereitschaft, nicht nur das eigene, sondern das Leid der anderen wahrzunehmen, gebe es keine tragfähigen politischen Kompromisse. Als politisches Symbol wechselseitiger Leid-Anerkennung erinnerte Schöttler an den Handschlag zwischen Rabin und Arafat 1993. Aus dieser Perspektive werden informelle Begegnungen zu Wegbereitern politischer Verständigung.
In der lebhaften Diskussion wurde die Ambivalenz von Hoffnung ausgelotet. Aus dem Publikum kam die kritische Rückfrage, ob Hoffnung nicht zur Ressource der Privilegierten werde oder gar als „Opium“ wirke, und ob Gespräche mit autoritären Akteuren riskieren, diese zu legitimieren. Suermann antwortete ohne Beschönigung: Hoffnung ist nie naiv, sondern risikoreich – sie kann ausgenutzt werden, bleibt aber unverzichtbar, um Bindungen, Handlungsfähigkeit und Gemeinsinn zu erhalten. Am Beispiel Syriens skizzierte er die Rolle religiöser Führungspersonen, die – bei klarem Blick für Risiken – Menschen ermutigen, im Land zu bleiben, sich zu engagieren und Zivilgesellschaft zu stützen; gerade kleine, konkrete Initiativen für Bildung, Ernährungssicherheit und Zusammenhalt erwiesen sich als belastbare Hoffnungsquellen.
In diese Richtung wies auch ein zentraler Gedanke des Erstpreisträgers Tommy Seefeld. Sein Essay über „Atombomben, tanzende Skelette und Lämmer“ lenkt den Blick auf das Verdrängte: den Tod als radikalen Gleichmacher. In Kriegsdiskursen dominiert das Zählen und Vergleichen; Namen verlieren sich in Zahlen, Trauer zerfällt in getrennte Lager. Seefeld forderte, das Unsagbare zur Sprache zu bringen und das Ende – unsere gemeinsame Endlichkeit – als Brücke zu begreifen: „Lasst uns mehr darüber reden, was uns am Ende eint – das Ende selbst.“ Gegen die Normalisierung des Ungeheuerlichen, die er als „Groteske“ beschreibt, setzt er eine umfassende spirituelle Annahme: der Glaube (religiös oder existenziell), dass Handeln Sinn hat, wird zum Antrieb, nicht zu resignieren, sondern Dialog zu führen – auf der Bühne wie am Küchentisch.
Besonders plastisch wurde die Bedeutung informeller Räume durch die Perspektive der Zweitplatzierten Julia Verbeek. Sie argumentierte, dass formelle Podien zwar Öffentlichkeit und Struktur erzeugen, Vertrauen aber vor allem in der Kaffeepause, auf dem gemeinsamen Weg oder im Spiel wächst. Ein Jugendcamp mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Israel, Palästina und europäischen Ländern – ohne Konfliktagenda, mit kreativen Social-Media-Projekten – habe gezeigt, wie beiläufige Begegnungen Abwehr senken und belastbare Gespräche überhaupt erst ermöglichen. Interreligiöser Dialog nährt sich von „Podium und Kaffeeklatsch“, so ihr Votum.
Ein weiteres Praxisfenster öffnete der Drittplatzierte Sohaib Nasir. In seinem Essay „Der Islam und Deutschland: Ein Kapitel der Geschichte, ein Thema der Gegenwart“ verbindet er historischen Tiefgang mit Gegenwartsanalyse und persönlicher Erfahrung als muslimischer Gefängnisseelsorger. Nasir entlarvt verbreitete Vorurteile, erinnert an die lange Wirkungsgeschichte islamischer Wissenschaft und Kultur in Europa und plädiert für konkrete Schritte: Ausbau einer integrierten muslimischen Wohlfahrt, in Deutschland verankerte Imam-Ausbildung sowie die Stärkung interreligiöser Bildungs- und Dialoginitiativen. In der Seelsorgepraxis zeigt sich, wie Hoffnung gegen Hoffnungslosigkeit wirksam werden kann: durch Gespräch, Gebet, Verantwortung und Resozialisierung. Theologisch verankert er dies in der Spannung von menschlicher Fehlbarkeit und göttlicher Barmherzigkeit; Reue (Tawba) und gute Taten erneuern, die Rechte Gottes und die Rechte der Menschen bleiben in Balance.
Die drei prämierten Essays können hier heruntergeladen werden.
Die Preisträgerin und die Preisträger schilderten zudem, wie sie die Studienwoche geprägt hat. Seefeld sprach von einem „Rundgang um dasselbe Thema“: Unterschiedliche disziplinäre und religiöse Blickwinkel blieben bestehen, aber die gemeinsame Verantwortung wuchs. Verbeek beschrieb den Lernweg zwischen theologischen und sozialwissenschaftlichen Logiken, die nicht selbstverständlich kompatibel sind und im Dialog erst anschlussfähig gemacht werden müssen. Nasir nannte als prägende Momente die gemeinsamen Besuche von Basilika und Moschee, geteilte Zimmer und abendliche Gespräche, die Vertrauen schufen und – über die Vorträge hinaus – eine nachhaltige Wirkung entfalteten.
So verdichtete der Abend, was die Studienwoche insgesamt auszeichnete: Friedensethik braucht Theologien, braucht Praxis und die Kunst des Zuhörens. Wo formelle Debatten und informelle Nähe ineinandergreifen, entstehen Vertrauen, Mut und konkrete Schritte – klein, aber tragfähig.
Am Ende stand ein einfaches Wort, das den Geist des Abends einfing: Vertrauen. Es verbindet die Suche nach Gerechtigkeit mit der Praxis des Friedens, es hält Kritik und Hoffnung zusammen und gibt dem langen Atem der kleinen Schritte Richtung.