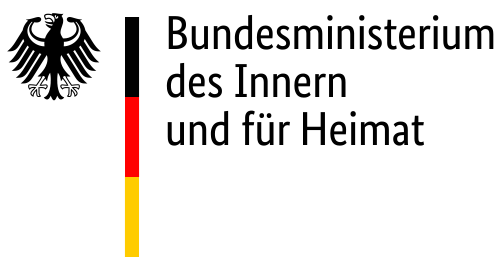Mehr als 120 Wissenschaftler haben beim Theologischen Forum Christentum – Islam über Flucht, Vertreibung und Migration diskutiert.
Die aktuelle Migrationsdebatte darf nach Ansicht des renommierten Philosophen Bernhard Waldenfels nicht auf das Eigene und das Fremde reduziert werden. In der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart verwies der emeritierte Professor der Ruhr-Universität Bochum darauf: „die Fremdheit nistet im Eigenen“, ja, das Eigene sei gar nicht denkbar ohne das Fremde.



Weder auf seinen Namen, noch auf die soziale Herkunft, die Kultur oder sein Land habe der Einzelne einen Einfluss, weil er hineingeboren werde. Eigenes und Fremdes bildeten vielmehr ein unentwirrbares Geflecht von Beziehungen, die jeweils Neues schafften. „Jede Form von Reinheit ist ein Wahn, wenn sie die Fremdheit ausschließen will“, sagte Waldenfels.
Waldenfels räumte ein, dass die Globalisierung nicht nur eine Vervielfältigung der Möglichkeiten sei, sondern von den Menschen auch als eine Gefahr für ihr angestammtes Umfeld wahrgenommen werde: „Das Hier verflüchtigt sich in ein diffuses Überall“, sagte Waldenfels vor mehr als 120 Wissenschaftlern aus mehreren Ländern in Stuttgart-Hohenheim. Wenn ein Flüchtling, ein Vertriebener oder ein Migrant in einer konkreten Notsituation vor einem stehe, sei man gezwungen zu reagieren. „Wir müssen eine Antwort geben“, so Waldenfels, „hier beginnt responsive Politik und Verantwortungsethik“.
Sichtweisen eines Geflüchteten vermittelte Professor Reza Hajatpour von der Universität Erlangen-Nürnberg. Der aus dem Iran stammende Islamische Theologe floh „aus religiösen Gründen aus einem religiösen Staat“ und verarbeitete seine Erfahrungen literarisch. Er las aus seinem Werk „Der brennende Geschmack der Freiheit“. Freiheit und Exil sind seine zentralen Begriffe: „Wir sehen überall Fremde, denn wir sind Wanderer. Unser Leben ist Exil, die Frage ist, woher ich komme und wohin ich gehe.“
Der Religions- und Sozialwissenschaftler Professor Martin Baumann von der Universität Luzernverwies auf veränderte Wahrnehmungen. Bis vor 30 Jahren habe man Zuwanderer als Fremde, als Gastarbeiter auf befristete Zeit gesehen; „inzwischen wurden aus Ausländern Muslime.“ Die Religion rücke in den Vordergrund und darauf reagierten viele Menschen mit Befremden, Unverständnis und Abwehr. Baumann wendete sich gegen einen Alarmismus und eine Defizitorientierung. Nötig sei ein ruhigerer sachlicher Dialog und ein Blick auch für die Integrationspotentiale von Religion. So seien Moscheen nicht nur religiöse Zentren, sondern „multifunktionale Dienstleistungszentren“. Sie seien Anlaufpunkt für informelle Beratung und vermittelten ebenso heimatliche Popmusik wie Nachhilfe, Essen oder Vorbereitungen für den Führerschein. Vielen Neuankömmlingen sei das hilfreich bei der Integration im sozialen Nahfeld. Gleichwohl sei wichtig, sich von mitgebrachten Konflikten und Machtstrukturen der Heimatländer zu lösen, um nicht in Sackgassen zu enden. Insgesamt seien Migration und Flucht vielschichtige Prozesse, die nicht nur durch „push- und pull-Faktoren“ erklärbar seien und die nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Gesellschaft und die Religionsgemeinschaften verändern.
Der Bochumer Bibelwissenschaftler Professor Jürgen Ebach rief in Erinnerung, wie häufig und nachdrücklich die biblischen Texte Rechtsnormen einschärfen wie „Du sollst die Fremden nicht bedrücken“. Die vielen Flüchtlingserzählungen seien literarisch verdichtete Erfahrung und dabei werde biblisch gerade nicht unterschieden zwischen politisch Verfolgten, sozial Unterdrückten oder „Wirtschaftsflüchtlingen“. Die Bibel habe selbst einen „Migrationshintergrund“ und „wäre ohne diese Traditionen nicht, was sie ist“, sagte Ebach. Er verwies aber auch darauf, dass die Bibel nicht nur von Solidarität berichte, sondern auch von schroffer Abgrenzung von Fremden – oftmals als Ausdruck einer Schwäche der eigenen Identität.
Die Juniorprofessorin für Ideengeschichte des Islam an der Universität Frankfurt, Armina Omerika, veranschaulichte die Bedeutung von Flucht und Vertreibung im Islam mit Verweis auf den Kalender: Er beginnt im Jahr 622 mit der Auswanderung des Propheten von Mekka nach Medina. Der Koran fordere, nicht nur den nahen, sondern auch den „fernstehenden Nachbarn“ gut zu behandeln. Für die Muslime in Deutschland und Europa seien Fragen von Flucht und Migration besonders relevant aufgrund der eigenen Erfahrungen: Der Islam als „eingewanderte“ Religion sei Gegenstand von Debatten und der Umgang mit Vielfalt keineswegs nur harmonisch. Muslime seien aber nicht nur Betroffene, sondern auch Akteure, die gerade in der Flüchtlingsarbeit Brücken bauen können. Klassische islamische Denkmuster könnten dabei teilweise neue Relevanz bekommen, seien aber auch kritisch darauf zu prüfen, ob sie für die gegenwärtigen Situationen noch passen. Diese Debatten stünden erst am Anfang.
Die aus Pakistan stammende und in Edinburgh als Professorin für Islamwissenschaft und vergleichende Religionswissenschaften lehrende Mona Siddiqui beobachtete eine Vermischung von Migrations- und Islamfragen. Sie erinnerte an das im Koran und der islamischen Tradition tief verwurzelte Gebot der Gastfreundschaft für den Fremden. Dabei gehe es nicht nur um Empfindungen und bloße Toleranz, sondern eine individuelle und gesellschaftliche Pflicht zu Fürsorge. Siddiqui erinnerte an islamische Reise-Erzählungen, die zeigten, dass es dabei um einen „Aufbruch im Kopf“ geht, der „neue Horizonte schafft“. Die Zuwendung zum Fremden sei herausfordernd und auch ein Risiko, aber es gebe keine Alternative zum Zusammenleben und „ohne Risiko auch keine persönliche und gesellschaftliche Transformation“. Heute sei die Angst vor Fremdem und vor Terrorismus größer als die Tradition der Gastfreundschaft. Dabei sei dies vornehmste Menschenpflicht. „Wir müssen akzeptieren, dass wir alle Gast sind und füreinander leben“, sagte Siddiqui.
Einen Perspektivwechsel forderte Katharina Karl. Die Professorin für Pastoraltheologie und Religionspädagogik in Münster erinnerte daran, wie lange man auf Zuwanderung mit der Erwartung von Assimilation reagiert hat. Angemessener sei, von „Einheit in Verschiedenheit“ auszugehen. Zurecht habe Papst Franziskus gefordert, an die Ränder zu gehen, zu den Armen und Bedürftigen, und nicht nur auf sich selbst zu blicken. Das „Fremde“ sei nicht fern, sondern alltäglich nah und verändere einen selbst. Die Zukunft liege dort, wo sich Kulturen begegnen, so Professorin Karl mit Blick auf das Buch von Vergilio Elizondo, „The Future is Mestizo“. Sie zitierte aus einem palästinensischen Gedicht, „lasst uns gehen, wir sind verbunden und getrennt. Lasst uns zusammen gehen und freundlich sein.“
Professor Abdullah Takim von der Universität Wienzitierte den Propheten Muhammad: „Sei auf der Welt wie ein Fremder oder wie ein Durchreisender“. Die Erde sei in islamisch-theologischer Sicht nicht der eigentliche Ort des Menschen, sondern Durchgangsort auf dem Weg zu Gott, und die Erde sei nicht Besitz des Menschen, sondern ihm anvertraut – und das befähige und verlange, davon zu teilen und auch „Fremde“ zu beheimaten. Der Koran verbinde dabei Glaube und Handeln: Glaube ohne Praxis sei nur eine leere Hülle und gutes Handeln, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit schulde der Muslim nicht nur Gläubigen, sondern allen Menschen.
Regina Polak legte aus katholischer Sicht dar, dass sich die internationalen Migrationen als „Zeichen der Zeit“ verstehen lassen: „Sie zeigen etwas an und fordern zu etwas auf“. Wenn Gott an diesen Orten gegenwärtig ist, dann ist eine neue theologische und ethische Bewusstseinsbildung verlangt. Die Professorin für Praktische Theologie und Religionsforschung an der Universität Wien betonte die große Bedeutung, die die Katholische Kirche dem Thema beimesse als strukturelle Komponente der gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Realität. Sie zitierte aus dem kirchlichen Dokument „Die Liebe Christi zu den Migranten“ von 2004: „Der Übergang von monokulturellen zu multikulturellen Gesellschaften kann sich so als Zeichen der lebendigen Gegenwart Gottes in der Geschichte und in der Gemeinschaft der Menschen erweisen, da er eine günstige Gelegenheit bietet, den Plan Gottes einer universalen Gemeinschaft zu verwirklichen.“ Das werfe nicht nur die ethische Frage nach einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung und einer gerechteren Verteilung der Güter der Erde auf. Nötig sei auch, im Bildung- und Pastoralbereich die Weltgemeinschaft insgesamt in den Blick zu nehmen.
Zur Veranstaltung: Migration, Flucht, Vertreibung – Orte islamischer und christlicher Theologie